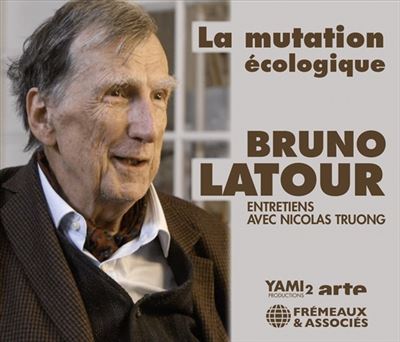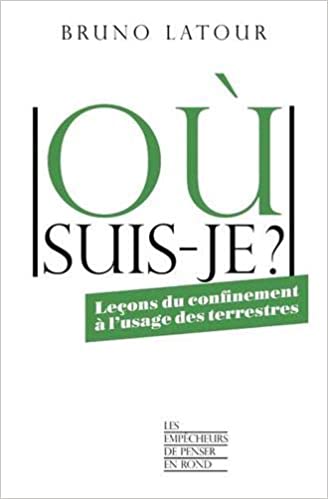Gestern abend habe ich bei John Berger gelesen (und dabei an Elon Musk gedacht):
Die Tatsache, dass die Tyrannen der Welt ex-territorial sind, erklärt das Ausmaß ihrer Überwachungsmacht, weist aber auch auf eine kommende Schwäche hin. Sie operieren im Cyberspace und residieren in bewachten Zonen. Sie haben keine Kenntnis von der sie umgebenden Erde. Außerdem tun sie dieses Wissen als oberflächlich und nicht tiefgründig ab. Nur die extrahierten Ressourcen zählen. Sie können nicht auf die Erde hören. Auf dem Boden sind sie blind. Im Lokalen sind sie verloren.
Für die Mitgefangenen ist das Gegenteil der Fall. Die Zellen haben Wände, die sich über die ganze Welt hinweg berühren. Wirksame Aktionen des nachhaltigen Widerstands werden nah und fern in das Lokale eingebettet sein. Widerstand im Outback, auf die Erde hören. (“Meanwhile,” Übersetzung mit deepl.com, von mir redigiert, in Berger, 2016)
Seit Dienstag, als ich mit Ana in der Dramatisierung seines Romans A und X im KiG gewesen bin, gehen mir Formulierungen Bergers durch den Kopf. Schon länger denke ich über die Bedeutung des Lokalen, des Orts, im Kampf gegen die Klimakatastrophe und die mit ihr verknüpften Krisen nach. Den Horizont dafür bildet für mich der Begriff der geosozialen Klasse (Latour & Schultz, 2022).
Continue reading →